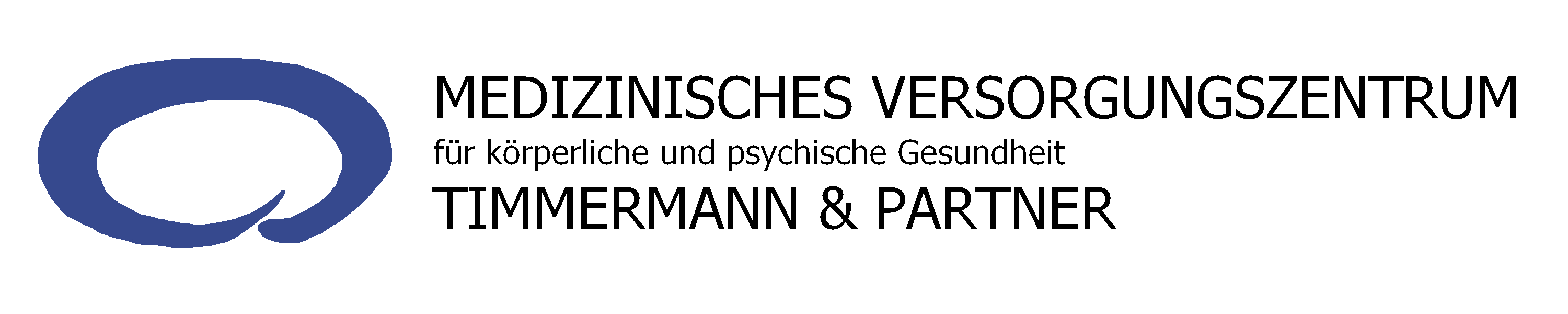Die Folgen von Krieg, Verfolgung und Flucht können an vielen der Flüchtlinge gar nicht spurlos vorbeigegangen sein – aber bei der psychiatrischen und psychologischen Versorgung gibt es noch viele weiße Flecken. „Was können wir tun, damit wir nicht bald vor einem Problem stehen, das wir nicht lösen können?“ – diese Frage stellte Jochen Timmermann zu Beginn eines Runden Tischs, bei dem sich Vertreterinnen und Vertreter diverser Institutionen ein Bild machen wollten.
Jochen Timmermann, ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums Timmermann und Partner, Dr. Lothar Rehberg, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Landkreises, und Dr. Michael Bodanowitz, Vorsitzender des Ärztevereins Cuxhaven, hatten eingeladen.
Schon jetzt kaum noch Luft
Jochen Timmermann stellte fest: „Schon jetzt – ohne diese zusätzliche Aufgabe – sind wir an den Grenzen der Belastbarkeit in der ambulanten und stationären Behandlung, die Wartezeiten sind lang.“ Unwägbarkeiten gebe es für Helfer viele: Angefangen bei der Sprachbarriere über die Unkenntnis der Lebensumstände und körperliche Krankheiten bis hin zum oft ungeklärten rechtlichen Status, wodurch auch Fragen zur Honorierung offen bleiben.
Ziel könne es nur sein, ein institutionsübergreifendes Projekt auf die Beine zu stellen, das von vielen getragen werde.
Ulrike Amoneit, Fachbereichsleiterin Therapie und Soziales im MVZ, stellte ein Modell aus Regensburg vor, das eng auf ehrenamtliche Laienhelfer setzt. Die Trauma-Helfer werden in 16 Unterrichtseinheiten an zwei Tagen zertifiziert. Sie arbeiten in einem niedrigschwelligen Hilfsangebot: Gruppen bis zu zehn Personen, altersgerecht zusammengesetzt.
In jeder Stunde ist auch ein Profi dabei. Es gehe dabei darum, eine Traumatisierung zu erkennen und deren Folgesymptome zu reduzieren, aber auch bei schweren Problemen schnell den Weg zur fachärztlichen Behandlung zu bahnen, so Amoneit.
Kommen nicht zur Ruhe
Dabei sei diese nur bei zehn Prozent der Betroffenen erforderlich. „Die meisten leiden an Schlaflosigkeit, erleben immer wieder ihre Fluchtsituation und kommen nicht zur Ruhe“, berichtete Frieda Timmermann über die Erfahrungen in Regensburg.
Andere Beispiele, von denen sich die lokalen Akteure etwas abschauen könnten, sind rar. Noch seien aber auch längst nicht alle Probleme zutage getreten. Lothar Rehberg sprach von einer „Honeymoon-Phase“: Noch sei alles neu, doch darauf folge eine „Phase der kritischen Anpassung“, in der die Menschen verwundbar seien.
Neben den Erlebnissen vor und auf der Flucht zerren auch die Unsicherheit über die Zukunft, die Trennung von Freunden und Familie während der Flucht und Erwartungen der Familie in der Heimat an den Nerven.
Dr. Gisela Penteker, aktiv in der Flüchtlingshilfe in Niedersachsen und dem Kreis, verdeutlichte, wie entscheidend es sei, Gefährdete frühzeitig zu erkennen und diesen Wohnorte zuzuweisen, in denen eine Therapie auch möglich ist: „Wenn jemand in Bülkau-Aue sitzt, ist das schwierig.“
Spannungen vermeiden
„Wir dürfen unsere Ressourcen nicht für Taxifahren vergeuden“, fand auch Dr. Carsten Rieck, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, und betonte ebenso: „Sammelunterkünfte erzeugen psychosoziale Spannungen.“ „Das Problem ist, dass wir zu wenige Sozialarbeiter haben, die Probleme erkennen könnten“, gab Gisela Penteker zu bedenken. Die Betroffenen wiederum hätten Angst, sich zu öffnen und Probleme einzugestehen, weil sie nicht wüssten, was mit ihren passiere.
Von Maren REESE-WINNE, Cuxhavener Nachrichten